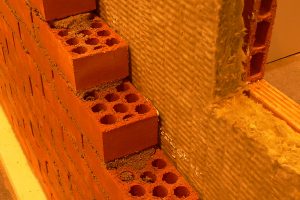Wann ist eine Innendämmung sinnvoll?
Eine Innendämmung ist besonders dann sinnvoll, wenn bauliche Gegebenheiten eine Außendämmung unmöglich machen. Dies trifft häufig zu bei:
- Denkmalschutz: Historische Gebäude mit erhaltenswerten Fassaden, wie Stuck oder Fachwerk, dürfen oft nicht von außen verändert werden.
- Enge Platzverhältnisse: Befindet sich das Gebäude zu nah an Nachbarhäusern oder -grundstücken, kann eine Außendämmung möglicherweise die Grundstücksgrenzen überschreiten und ist daher nicht machbar.
- Teileigentum: In Mehrfamilienhäusern, in denen die Eigentümergemeinschaft eine Außendämmung ausgeschlossen hat, können einzelne Wohnungen durch Innendämmung energetisch verbessert werden.
- Kellerräume: Bei Kellern, die aufgrund ihrer Bauweise von außen nicht gedämmt werden können, stellt die Innendämmung eine praktikable Lösung dar.
Zusätzlich kann eine Innendämmung kostengünstiger sein, da kein Baugerüst benötigt wird. Sie können auch einzelne Gebäudeabschnitte nacheinander Schritt für Schritt sanieren, was bei einer Außendämmung meist nicht möglich ist.
Besonders empfehlenswert ist eine Innendämmung bei einer energetischen Sanierung mit neuen Fenstern. Da moderne Fenster besser isolieren und dichter sind, steigt die Luftfeuchtigkeit im Innenraum. Eine entsprechende Innendämmung hilft, Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr an kalten Wandbereichen zu verhindern.
Es ist wichtig, dass die Arbeiten von Fachkräften durchgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wenn diese Aspekte sorgfältig beachtet werden, können Sie durch eine Innendämmung erheblich Heizkosten einsparen und die Umwelt schonen.
Welche Möglichkeiten der Innendämmung gibt es?
Bei der Innendämmung haben Sie verschiedene Optionen, je nach den spezifischen Anforderungen Ihres Gebäudes. Hier sind einige gängige Methoden, die unterschiedliche Materialien und Techniken umfassen:
1. Dämmung mit Unterkonstruktion:
- Sie befestigen Dämmplatten auf einer Unterkonstruktion aus Holz oder Metall. Diese Platten bestehen oft aus Polystyrol oder Mineralwolle.
- Hohlräume zwischen den Platten können mit losem Dämmstoff, beispielsweise Zelluloseflocken, gefüllt werden, was für eine gleichmäßige Dämmung sorgt.
- Eine Dampfbremsfolie auf der Innenseite verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
2. Dämmung mit Verbundplatten:
- Hierbei sind die Dämmstoffe und die Deckplatte bereits miteinander verklebt. Das vereinfacht die Installation und eignet sich gut für glatte Wandflächen.
- Zusätzliche Dampfsperren können angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren.
3. Dämmputzsysteme:
- Ein alternatives Verfahren umfasst das Nassverputzen, bei dem eine Dämmplatte direkt an die Innenwand gedübelt oder geklebt wird.
- Diese Technik eignet sich besonders für unebene Wände und bietet gleichzeitig eine robuste Oberfläche.
4. Aufsprühdämmung:
- Für unregelmäßige oder schwer zugängliche Flächen wie Gewölbe oder geschwungene Wände verwenden Sie aufsprühbare Dämmstoffe wie Zelluloseflocken.
- Diese Methode ermöglicht eine lückenlose und flexible Anpassung an die zu dämmende Oberfläche.
5. Verwendung von Naturdämmstoffen:
- Wenn Sie Wert auf ökologische Nachhaltigkeit legen, können Sie auch natürliche Materialien wie Kalziumsilikat, Holzfaser, Hanf oder Blähperlit verwenden.
- Diese natürlichen Dämmstoffe bieten gute Dämmwerte und tragen zur Verbesserung des Raumklimas bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren.
6. Schimmelschutzmaßnahmen:
- Spezielle diffusionsoffene Dämmplatten, zum Beispiel aus Kalziumsilikat oder Mineralschaum, helfen, Schimmelbildung zu verhindern.
- Eine dampfoffene Behandlung ist hier essentiell, um Feuchtigkeitsprobleme zu minimieren und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
Jede Methode hat ihre spezifischen Vorteile und Herausforderungen. Es ist ratsam, sich von einer Fachkraft beraten zu lassen, um die geeignete Lösung für Ihre Bedürfnisse und Ihre baulichen Gegebenheiten zu finden.
Worauf sollten Sie bei der Innendämmung achten?
- Trockenheit und Dichtheit der Außenwand sicherstellen: Die Außenwand sollte trocken und gegen Schlagregen geschützt sein. Es ist wichtig, auf mögliche Zutrittspunkte für Feuchtigkeit zu achten, um Frostschäden und Schimmelbildung zu verhindern. Ein Fachexperte kann die Fassade auf solche Mängel überprüfen.
- Sorgfältige Anbringung der Dämmung: Der Dämmstoff muss vollständig und flächendeckend auf der Wand aufliegen, um Hohlräume zu vermeiden. Diese könnten sonst zur Kondensation von Feuchtigkeit und zur Entstehung von Schimmel führen.
- Geeignete Materialien und Konstruktionen wählen: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Materialien für Ihre spezifischen baulichen Anforderungen geeignet sind. Ob diffusionsbremsende oder diffusionsoffene Systeme besser passen, hängt von Ihren individuellen Gegebenheiten ab.
- Richtige Dämmstoffdicke und -einsatz: Die Dämmstoffdicke sollte passend zu den räumlichen Gegebenheiten und der gewünschten Dämmwirkung ausgewählt werden. Diese lässt sich am besten in Absprache mit einem Fachunternehmen bestimmen, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Lückenlose und luftdichte Ausführung: Eine lückenlose Ausführung der Dämmung, besonders an kritischen Stellen wie Fensterlaibungen und Deckenanschlüssen, ist entscheidend. Dampfsperren und Dampfbremsfolien müssen präzise installiert werden, um Luftfeuchtigkeit fernzuhalten und Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern.
- Regelmäßiges Lüften: Passen Sie Ihr Lüftungsverhalten an die veränderten Bedingungen an. Regelmäßiges Stoßlüften mehrmals täglich hilft, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren und somit Schimmelbildung zu vermeiden.
- Fachkundige Planung und Überwachung: Lassen Sie die Planung und Durchführung von qualifiziertem Fachpersonal übernehmen. Auch die Kontrolle durch einen Baubegleiter kann Planungsfehler verhindern und sicherstellen, dass alle Arbeiten korrekt ausgeführt werden.
Durch sorgfältige Beachtung dieser Punkte erhöhen Sie die Wirksamkeit der Innendämmung und tragen zu einem besseren Raumklima sowie einem effizienteren Energieverbrauch bei.